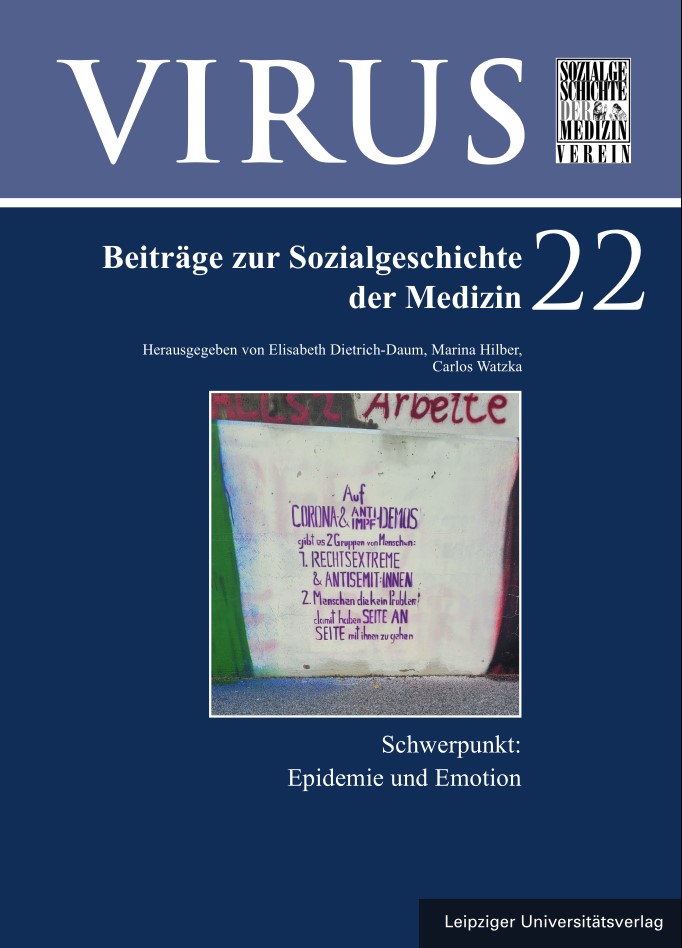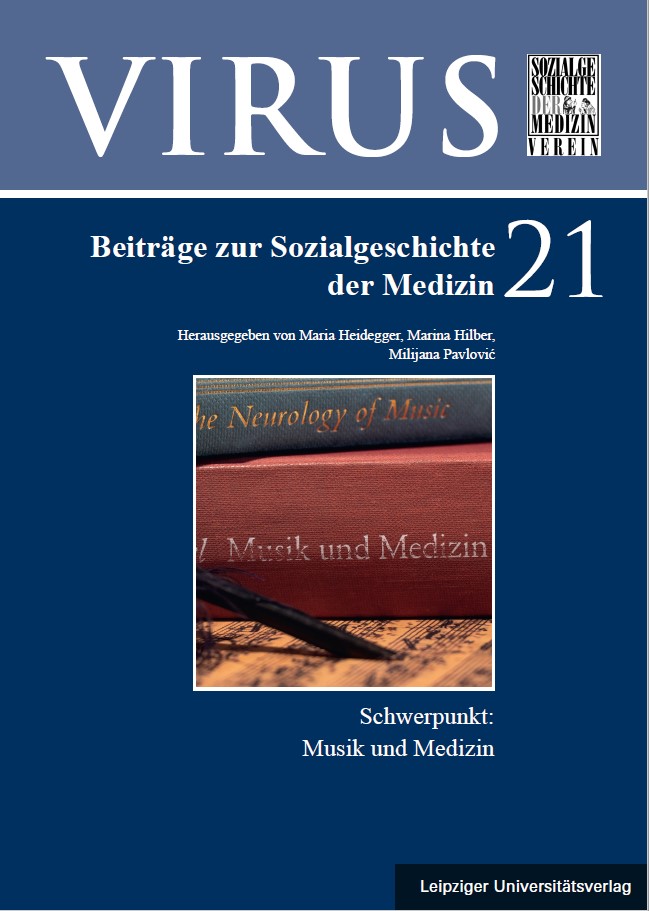Call for Papers, Jahrestagung 2024
Handgriffe
Zur Bedeutung von Hand und Werkzeug für die Heilberufe
Den deutschsprachigen CfP können Sie hier downloaden:
Ort der Tagung:
Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt
Anatomiestraße 18-20
85047 Ingolstadt
Zeitraum:
12./13. September 2024
Veranstalter:
Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt
Institut für Geschichte der Medizin, Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Universität Innsbruck
Verein für Sozialgeschichte der Medizin
Organisationsteam:
Marina Hilber
Marion Ruisinger
Sabine Schlegelmilch,
Alois Unterkircher
13. Dezember 2023
Tagungsbericht zur Jahrestagung 2023
Mensch – Tier – Gesundheit
Zur Kultur- und Sozialgeschichte der
Mensch-Tier-Beziehungen in der Medizin
Tagungsbericht von Sophia Bauer und Leo Schaukal, Mensch – Tier – Gesundheit. Zur Kultur- und Sozialgeschichte der Mensch-Tier-Beziehungen in der Medizin, In: H-Soz-Kult, 13.12.2023, https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-140519.
7. Dezember 2023
Der VIRUS Band Nr. 22 zum Schwerpunktthema
„Epidemie und Emotion“
ist nun erschienen.
Herzlichen Dank an alle Autorinnen und Autoren für die interessanten Beiträge!
Haben Sie Interesse an dieser Publikation?
Besuchen Sie uns unter https://austriaca.at/VIRUS_collection?frames=yes
Schreiben Sie uns eine Mail an verein@sozialgeschichte-medizin.org oder bestellen Sie das Buch direkt beim Leipziger Universitätsverlag!
Die Herausgeber*innen
Elisabeth Dietrich-Daum / Marina Hilber / Carlos Watzka
5. September 2023
Mensch – Tier – Gesundheit
Zur Kultur- und Sozialgeschichte der
Mensch-Tier-Beziehungen in der Medizin
Jahrestagung 2023 des Vereins für Sozialgeschichte der Medizin – Geschichte(n) von Gesundheit und Krankheit
Ort der Tagung: Josephinum, Sammlungen der Medizinischen Universität Wien und
Jugendstilhörsaal, Rektoratsgebäude, 1090 Wien
Zeitraum: 26.-27. September 2023
Veranstaltende Organisationen:
Ethik, Sammlungen und Geschichte der Medizin, Medizinische Universität Wien
Verein für Sozialgeschichte der Medizin
Organisationsteam:
Monika Ankele (MedUni Wien)
Marina Hilber (Universität Innsbruck)
Maria Heidegger (Universität Innsbruck)
Tagungsgebühr: 100 € bzw. 75 € für Mitglieder des Vereins für Sozialgeschichte der Medizin
Tagungsanmeldung:
verein@sozialgeschichte-medizin.org
Das Programm der Tagung kann man hier downloaden!
28. März 2023
Der VIRUS Band Nr. 21 zum Schwerpunktthema
„Musik und Medizin“
ist nun erschienen.
Herzlichen Dank an alle Autorinnen und Autoren für die interessanten Beiträge!
Haben Sie Interesse an dieser Publikation?
Besuchen Sie uns unter https://austriaca.at/VIRUS_collection?frames=yes
Schreiben Sie uns eine Mail an verein@sozialgeschichte-medizin.org oder bestellen Sie das Buch direkt beim Leipziger Universitätsverlag!
Die Herausgeberinnen
Maria Heidegger / Marina Hilber / Milijana Pavlović
7. Dezember 2022
Call for Papers, Jahrestagung 2023
Mensch – Tier – Gesundheit
Zur Kultur- und Sozialgeschichte der Mensch-Tier-Beziehungen in der Medizin
Den deutschsprachigen CfP können Sie hier downloaden:
Ort der Tagung: Josephinum – Medizinhistorisches Museum Wien
Währinger Straße 25, 1090 Wien
www.josephinum.ac.at
Zeitraum: 26./27. September 2023
Veranstaltende Organisationen:
Verein für Sozialgeschichte der Medizin in Kooperation mit
Organisationseinheit Ethik, Sammlungen und Geschichte der Medizin der Medizinischen Universität Wien
Forschungszentrum Medical Humanities und dem Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck
Organisationsteam:
Monika Ankele (Wien)
Maria Heidegger (Innsbruck)
Marina Hilber (Innsbruck)
21. September 2022
Tagungsbericht zur Jahrestagung 2022
Epidemie und Emotion – geschichtswissenschaftliche und transdisziplinäre Perspektiven
Tagungsbericht von Lisa Maria Hofer, Epidemie und Emotion. Geschichtswissenschaftliche und transdisziplinäre Perspektiven, In: H-Soz-Kult, 20.09.2022, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-129584>.
23. Mai 2022
Epidemie und Emotion – geschichtswissenschaftliche und transdisziplinäre Perspektiven
Jahrestagung 2022 des Vereins für Sozialgeschichte der Medizin – Geschichte(n) von Gesundheit und Krankheit
Ort der Tagung: Sigmund Freud PrivatUniversität Linz, Adalbert-Stifter-Platz 2, 8. Stock 4020 Linz
Zeitraum: 23.-24. Juni 2022
Veranstaltende Organisationen:
Verein für Sozialgeschichte der Medizin
Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck
Forschungszentrum Medical Humanities der Universität Innsbruck
Department für Psychotherapiewissenschaft, Sigmund Freud PrivatUniversität Linz
Organisationsteam:
Marcel Chahrour (Linz)
Elisabeth Dietrich-Daum (Innsbruck)
Marina Hilber (Innsbruck)
Carlos Watzka (Linz)
Tagungsgebühr: 100 €
Tagungsanmeldung:
Manuel Morawek: manuel.morawek@sfu.ac.at
Gabriella Kovacs: gabriella.kovacs@sfu.ac.at
Tel.: 0732 99 57 99
Das Programm der Tagung kann man hier downloaden!
26. Jänner 2022 / 11. Mai 2022
Tagungsberichte zur Jahrestagung 2021
Musik und Medizin.
Musikwissenschaftliche und medizinhistorische Zugänge / Music and Medicine. Musicological and Medical-Historical Approaches
Conference Report by John Habron, Music and Medicine. Musicological and medical-historical approaches, in: Approaches. An Interdisciplinary Journal of Music Therapy, Advance Online Publication, https://approaches.gr/habron-cr20220107/
Conference Report by Maria Heidegger / Milijana Pavlović, Music Meets Medicine. A Conference Report, in: INSAM. Journal of Contemporary Music, Art and Technology 7/2 (2021), 91–94, https://insam-institute.com/insam-journal-issue-7/
Tagungsbericht von Paul Heidegger, Musik und Medizin. Musikwissenschaftliche und medizinhistorische Zugänge, 04.11.2021 – 06.11.2021 Innsbruck und digital, in: H-Soz-Kult, 07.05.2022, www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-9407
14. Oktober 2021
Call for Papers, Jahrestagung 2022
Epidemie und Emotion
Geschichtswissenschaftliche und transdisziplinäre Perspektiven
Den deutschsprachigen CfP können Sie hier downloaden:
Ort der Tagung: Sigmund Freud PrivatUniversität Linz, Adalbert-Stifter-Platz 2, 4020 Linz
Zeitraum: 23.-25. Juni 2022
Veranstaltende Organisationen:
Verein für Sozialgeschichte der Medizin
Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck
Forschungszentrum Medical Humanities der Universität Innsbruck
Department für Psychotherapiewissenschaft, Sigmund Freud PrivatUniversität Linz,
Organisationsteam:
Marcel Chahrour (Linz)
Elisabeth Dietrich-Daum (Innsbruck)
Marina Hilber (Innsbruck)
Carlos Watzka (Linz)
1. Oktober 2021
Musik und Medizin.
Musikwissenschaftliche und medizinhistorische Zugänge / Music and Medicine. Musicological and Medical-Historical Approaches
Jahrestagung 2021 des Vereins für Sozialgeschichte der Medizin – Geschichte(n) von Gesundheit und Krankheit
Ort der Tagung
Online – via Zoom
Zeitraum
4.–6. November 2021
Veranstaltende Organisationen
Verein für Sozialgeschichte der Medizin | Universität Innsbruck: Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Institut für Musikwissenschaft, Forschungszentrum Medical Humanities | Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen
Organisationsteam
Maria Heidegger (Universität Innsbruck)
Milijana Pavlović (Universität Innsbruck)
Organisation des Rahmenprogrammms
Franz Gratl (Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen)
Anmeldung zur Tagung
Hier anmelden.
Das Programm der Tagung kann man hier downloaden!
3. September 2021
Open Access Archiv komplettiert
Um auch die Anfänge des Vereins für Sozialgeschichte der Medizin und seiner Zeitschrift recherchierbar zu machen, wurden nun die frühesten Ausgaben des VIRUS digitalisiert und kostenfrei verfügbar gemacht.
Ab sofort finden Interessierte die bisher erschienenen 19 Bänden des VIRUS. Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin frei zugänglich und downloadbar unter folgendem Link: https://austriaca.at/VIRUS_collection?frames=yes
11. Februar 2021
Call for Papers, Jahrestagung 2021
Musik und Medizin. Musikwissenschaftliche und medizinhistorische Zugänge
Den deutsch- und englischsprachigen CfP können Sie hier downloaden:
Ort der Tagung: Haus der Musik, Innsbruck
Zeitraum: 4.-6. November 2021
Veranstaltende Organisationen: Verein für Sozialgeschichte der Medizin / Universität
Innsbruck: Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie; Institut für
Musikwissenschaft / Forschungszentrum Medical Humanities; Musiksammlung der Tiroler
Landesmuseen
Organisationsteam: Maria Heidegger (Universität Innsbruck), Milijana Pavlović
(Universität Innsbruck)
14. Dezember 2020
VIRUS – Open Access Version
Die Vereins-Zeitschrift VIRUS. Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin ist nun auch digital verfügbar. 13 Bände des VIRUS (Band 6-18) wurden bereits online gestellt (die Bände 1-5 sind in Vorbereitung). Die einzelnen Hefte bzw. Einzelbeiträge sind über folgenden Link kostenfrei abrufbar: https://austriaca.at/VIRUS_collection?frames=yes
Auch alle zukünftigen Bände des VIRUS erscheinen Open Access d.h. werden digital frei zugänglich sein.